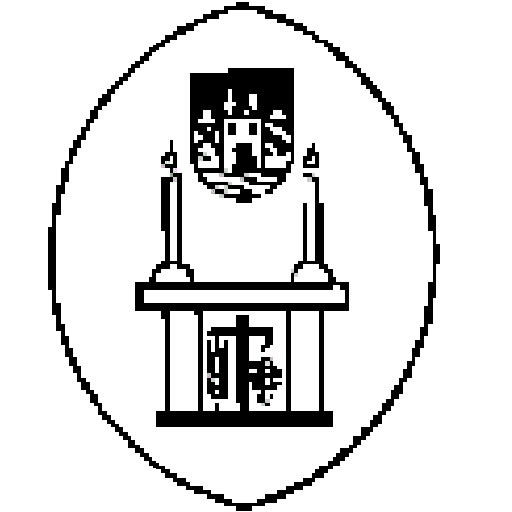Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Erster Petrusbrief 3, 15
Der mittelalterliche italienische Dichter und Philosoph Dante Alighieri (1265 – 1321) beschreibt in seinem berühmtesten Werk eine Reise durch das Universum.
Diese Reise führt ihn von der Hölle bis ins Paradies. Dabei wird Dante von unterschiedlichen Führern begleitet. In dem Gedicht wird die Hölle in Form von neun konzentrischen Kreisen der Qual dargestellt, die sich innerhalb der Erde befinden.
Beim Eintritt durch das Höllentor wird den Eintretenden gesagt: „Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!“ Dante zitiert hier einen altrömischen Spruch, der einst den Gladiatoren vor ihrem Auftritt in der Arena zugerufen wurde.
Diesen Spruch kannten die Apostel Jesu auch. Und sie wussten: Wer in die Arena geschickt wird, der muss mit dem Schlimmsten rechnen.
Doch selbst dort gibt es für die Gläubigen noch Hoffnung – selbst wenn sie sterben.
Es ist die Hoffnung, die über den Tod hinausreicht, weil unser Herr Jesus Christus auch nicht im Tod geblieben ist. Als Ersten von allen, die gestorben sind, hat ihm der Schöpfer des Lebens ein ganz neues und unvergängliches Leben gegeben nach seinem Tod und hat solches Leben allen verheißen, die seinem Christus nachfolgen.
Paulus hatte geschrieben (Röm 5,5): „Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, den die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist.“
Und Petrus fordert uns auf, über unsere Hoffnung jedem Rede und Antwort zu stehen, der darüber von uns Rechenschaft verlangt.
Von einem Missionar – er hieß ausgerechnet Hoffmann und er lebte unter den Papua in Neuguinea – wird Folgendes erzählt: Er wollte mit den Eingeborenen sprechen und ihnen das Evangelium erklären.
Dazu suchte er in der dortigen Sprache lange vergebens nach einem Wort für „Hoffnung“, aber er fand kein passendes. Da starb eines seiner Kinder, und als Hoffmann am Grab stand, da kam ein Eingeborener und fragte teilnahmsvoll: „Werdet ihr jetzt weggehen?“
„Nein“, antwortete Hoffmann, und er erklärte dem Eingeborenen, dass er auch um seine anderen Kinder keine Angst habe.
„O“, sagte der dann, „was seid ihr Christen für Menschen. Ihr habt andere Herzen als wir, aber nicht wahr, ihr könnt durch den Horizont sehen.“
Da leuchtete es in dem Missionar auf: „Das ist Hoffnung“, dachte er: durch den Horizont sehen. Das ist das richtige Wort.
Wir Christen feiern Ostern. Ein Leben in der Verbindung mit dem auferstandenen Christus heißt: Hoffnung behalten, auch in dunklen Zeiten. Das gilt für heute und für jeden neuen Tag.
Sieghard Löser